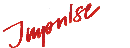Projektmanagement als Inszenierung von Störungen
Projektmanagement ist ein beliebtes Instrument, um Veränderungen und Entwicklungen in Organisationen voranzutreiben und zu steuern. Im ersten Augenblick mag der Beschluß „Das machen wir als Projekt“ erleichternd wirken, eine Garantie für das Gelingen darf jedoch allenfalls erhofft, aber längst nicht als sicher erachtet werden. MitarbeiterInnen, die schon lange dazugehören, können schon mal ihre Skepsis vortragen: „Wenn Sie mich fragen, daraus wird nichts!“ Vermutlich werden sie recht behalten, es sei denn … Was tun, damit Projekte gelingen? Meine These lautet: Der Erfolg liegt in der Kunst zur produktiven Inszenierung von Störungen.
Inszenierung des Auftrags
Im Coaching, das begleitend zur Projektmanagementschulung stattfand, hatte die Projektleiterin das Problem schnell benannt: weder der Produktionsleiter noch die Abteilung Forschung und Entwicklung kooperierten mit ihr. Zum Projektgruppenmeeting wurden schlecht informierte Vertreter geschickt, Zusagen wurden nicht eingehalten, und je mehr sie sich um die Erledigung der Aufgaben kümmerte, die diese Herren vor sich herschoben, desto schlimmer wurde es. Was war geschehen? Die F & E Abteilung des recht erfolgreichen Unternehmens für homöopathische Arzneimittel hatte in jahrelanger Arbeit ein neues Mittel entwickelt. In der hektischen Schlußphase einer Besprechung sagte der Geschäftsführer: „Sie haben ja jetzt die Projektmanagementschulung gemacht. Kümmern Sie sich bitte um die Markteinführung unseres neuen Produkts.“ Die Aufgabe war reizvoll und umfangreich: Verpackungsgröße und –formen festlegen, Beipackzettel nach gesetzlichen Vorgaben entwerfen, Werbemaßnahmen mit dem Außendienst koordinieren, Budget und Termine im Blick behalten - Aufgaben, bei denen sie fortlaufend die verschiedenen Fachkompetenzen zusammenführen mußte. Sie stand gegenüber ihrem Chef (und sich selbst) unter Erfolgsdruck und mußte sich der Einsicht beugen, dass alles andere wichtiger war wie „ihr“ Projekt. Die beinahe banale Standardfrage im Coaching „Wie lautet denn der Auftrag“ machte deutlich: es gab keinen schriftlichen Auftrag, ihre Rolle und noch mehr ihre Befugnisse waren reichlich unklar, offen war auch die Frage, wer denn nun tatsächlich zur Projektgruppe gehört. Die Vermutung wurde zur Gewißheit: das Projekt war in dem Unternehmen auf einem so geringen Level etabliert, dass es in den Alltagsroutinen der betroffenen Abteilungen und Mitarbeitern fast völlig unterging – und die Projektleiterin sich immer ohnmächtiger fühlte. Die Lösung des Problem war in diesem Fall verblüffend einfach: sie sorgte nun selbst für einen klaren Auftrag. Auf einer knappen DIN A 4 Seite erarbeitete sie sich ihren „Wunschprojektauftrag“, definierte darin Aufgabe, Ziele, Termine, Verantwortlichkeiten und Befugnisse. Diesen Auftrag legte sie dem Geschäftsführer zur Unterschrift mit den Worten vor „Ich habe mir Ihren Auftrag nochmals klar gemacht und zu Papier gebracht. Ist so das Projekt in ihrem Sinne?“ Den Auftrag zusammen mit der Unterschrift den entsprechenden Abteilungen bekannt zu machen, war dann ein Kleinigkeit mit großen Wirkungen: Das Projekt kam sehr erfolgreich ins Laufen.In den einschlägigen Handbüchern gibt es gute Hinweise und Vorlagen für die unterschiedlichsten Arten von Projekten. Man könnte meinen, es sei doch ein Leichtes für die Auftraggeber, einen Projektauftrag zu formulieren. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade die Auftragserteilung und –annahme längst nicht so einfach sind, wie sie scheinen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.
· Es gibt kaum eine Organisation, bei der sich die MitarbeiterInnen nicht auch ohne Projekte eigentlich ganz gut beschäftigt und ausgelastet fühlen. Sie haben im Rahmen der Linienorganisation ihr Aufgabenpaket, das sie auf Grund ihrer Erfahrungen in mehr oder weniger bewährten Arbeitsabläufen und Routinen bewältigen. Fast jedes Projekt unterbricht, beeinflußt und stört diese „normale“ Arbeit. Einerseits soll mit dem Projekt – häufig in gedrängter Zeit – ein wichtiges Ergebnis erzielt werden und gleichzeitig soll die übliche Arbeit nicht darunter leiden. Deshalb sind Projektaufträge (unbewußt / halbbewußt) oft seltsam unklar und diffus, nach dem Motto „wasch mit den Pelz, aber mach ihn mir nicht naß“. Natürlich konkurrieren Interessen, Ressourcen und Kapazitäten, gerade bei zeitlich begrenzten, zusätzlichen Projekten. In der Regel verfügt die gewachsene (Linien-)Organisation über wesentlich mehr Techniken und informelle Verfahrensweisen, Projekte ins Leere laufen zu lassen, wie dies die Projektorganisation in Bezug auf die Unterbrechung der normalen Arbeit es vermag. In der Regel ist es deshalb überhaupt nicht hilfreich, Projekte möglichst harmonisch und niederschwellig zu starten. Projekte „stören“, und diese Störung gilt es bereits in der Startphase bei der Auftragserteilung nicht nur zu akzeptieren, sondern sinnvoll zu inszenieren. · Der schwarze Peter liegt dafür jedoch längst nicht nur beim Auftraggeber, sondern auch beim Projektleiter und der Projektgruppe. Diese empfinden die Klärung der Frage „Was ist denn nun unser Auftrag?“ oft als eine lästige, weil für sie viel zu abstrakte Sache. Die Gedanken eilen voraus, wie denn die anstehenden Probleme gelöst werden können: man / frau beginnt zu arbeiten – und merkt gar nicht, dass möglicherweise die Rahmenbedingungen unzureichend sind.
In der Praxis sieht das dann so aus: Mit einem aufmunternden „Nun fangen sie erst mal an …“ wird die Projektgruppe auf den Weg geschickt - und sie läßt sich auf den Weg schicken. Wieviel Zeit dafür eingesetzt werden darf, wird nicht geklärt. Wann das Projekt abgeschlossen sein soll, kann man ja auch nicht bestimmen, das hängt von … ab. Und schon sind Reibungsverluste vorprogrammiert. Die Empfehlung heißt: die Zeit und Energie zur sorgfältigen Auftragserteilung und –annahme lohnt sich. Dazu gehört nicht nur die Klärung, was das gewünschte Ergebnis ist, sondern vor allem auch wie viel Zeit, Geld und Manpower in das Projekt einfließen darf. Und dazu gehört auch – trotz aller Unsicherheit – einen Schlußtermin zu setzen. Es ist leichter, einen solchen Termin zu verändern, als mit einem langsam dahinsiechenden, endlosen Projekt zu leben.Das Beispiel der Projektleiterin ist typisch: bei gelungen Projekten sind es häufig die Projektleiter oder Projektgruppen gewesen, die entweder den Auftrag zur Gänze selbst geschrieben, oder ihn zumindest in wesentlichen Punkten sorgfältig geprüft und modifiziert haben. Gerade in der Startphase einer Projektgruppe verhilft die konsequent gestellte Frage „was ist unser Auftrag“ dazu, nicht nur die unterschiedlichen Vorstellungen zu klären, sondern auch als Projektgruppe handlungsfähig und stabil zu werden.
Inszenierung der Projektorganisation
Die Pflegedienstleitung eines kleinen Krankenhauses mit 4 Stationen wollte die Ablauforganisation umstellen. Statt der Funktionspflege, bei der die Pflegenden jeweils für bestimmte Arbeiten wie Betten machen, Frühstück bringen, Verbandswechsel etc. zuständig waren sollte die Bereichspflege eingeführt werden. Hierbei ist die Pflegende für „ihren“ Bereich komplett zuständig, in der Regel für die Patienten von ein oder zwei Zimmern, und verrichtet alle anfallenden Arbeiten. Der Nutzen für die Patienten liegt auf der Hand, sie müssen sich nicht immer auf neue Gesichter einstellen und die Pflegende können sich auf einige Patienten speziell konzentrieren. Wohl wissend, dass der Wechsel von der Funktions- zur Bereichspflege eine weitreichende Veränderung der Arbeitsabläufe nicht nur für die Pflegenden sondern auch für die Ärzte und andere Berufsgruppen darstellt, entschied sich die PDL dafür, den Veränderungsprozess als Projekt zu organisieren. MitarbeiterInnen von den Stationen, die die komplexen Zusammenhänge der täglichen Arbeitsabläufe hautnaher und besser kennen wie sie, sollten aktiv und unmittelbar beteiligt sein. Doch wie soll nun die Projektgruppe zusammengestellt werden? Einige wichtige Kriterien waren schnell klar: Die PG soll nicht zu groß und nicht zu klein sein, also ungefähr 9 Mitglieder haben, die freiwillig diese Aufgaben übernehmen sollten. Wichtig war auch, dass sowohl Befürworter als auch Skeptiker in die PG sollten, sowie MitarbeiterInnen, die schon viele Jahre im Haus waren und solche, die gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. Eine Zusammenstellung also noch dem Maxmix – Prinzip: maximale Mischung. Aber keine Stationsleitungen! Diese Entscheidung kam aus der Beobachtung, dass die MitarbeiterInnen immer recht schnell den sehr gut und überlegt handelnden Stationsleitungen zustimmten, aber dabei auch ihre Fähigkeiten und Kompetenzen eher viel zu zurückhaltend einbrachten. Projektidee und die Kriterien für die PG wurden über die Stationsleitungen den MitarbeiterInnnen nahegebracht – und lösten viele Diskussionen aus. Die Transparenz der Kriterien und die offene Entscheidungsmöglichkeit erzeugten nicht nur eine breite Aufmerksamkeit für das Projekt, sondern brachten dann auch eine gut zusammengestellte PG zustande, in der verschiedene Interessen repräsentiert waren. Manche empfanden die Diskussionen um die Zusammensetzung als störend. „Sagt doch einfach, wer da rein soll, und fertig!“ Andere waren sich jedoch auch ganz sicher: „Ohne diese Diskussionen hätte die PG in der Folge viel weniger Akzeptanz und Rückhalt gehabt.“
In der Regel zeichnen sich Organisationen durch einigermaßen stabile Strukturen und Arbeitsabläufe aus. Das ist gut so, denn da weiß man / frau, wo sie dran sind. Zeitlich begrenzte Projekte, vor allem wenn es sich auch noch um Projekte zur Organisationsentwicklung handelt, bergen die Chance in sich, andere Kooperationen, Einflußkanäle und Machtkonstellationen auszuprobieren – wenn sie denn genutzt werden. Die Versuchung liegt nahe, die im Alltag bewährten Proporzregelungen auch für das Projekt anzuwenden, anstatt den Aufbau der Projektorganisation und die Besetzung von PG und Lenkungsausschuß stärker nach Kriterien zu orientieren, die für das Projektergebnis wichtig sind, auch wenn sie der bisherigen Kultur widersprechen. „Laßt uns möglichst rasch zur Sacharbeit kommen! So wichtig ist ja nun die Zusammensetzung auch nicht! Wir wollen keine Zeit verlieren!“ Mit solchen Sätzen werden chancenreiche, konstruktive Unterschiede zwischen der alltäglichen Linienorganisation und der Projektorganisation eingeebnet noch bevor sie richtig entstehen konnten. Dadurch werden gegebenenfalls entscheidende Möglichkeiten leichtfertig verspielt!
Maximen zur Inszenierung der Projektorganisation können sein: Primäre Orientierung am Projektziel und der Projektaufgabe bei der Zusammensetzung der PG, Transparenz der Entscheidungskriterien, bewußte Einbindung von Skeptikern, ein schlanker und sich wirklich nur auf die Anbindung zu den Entscheidungsträgern beschränkender Lenkungsausschuß, klare Berichtsstrukturen (orientiert an den Meilensteinen und nicht monatlich; schriftlich; Verzicht der Führungskräfte auf die Nutzung informeller Informationskanäle).
Die Kunst besteht darin, eine für die aktuelle Situation maßgeschneiderte Vorgehensweise zu erfinden. So entschied man sich in diesem Krankenhaus erst nach langer Diskussion, keine Ärzte in die Projektgruppe zu nehmen, was in einem anderen Fall und bei anderen Voraussetzungen sicherlich zielführend und naheliegend wäre. Externe Berater, weil sie „fremd“ sind und deshalb systeminternen Zwänge etwas weniger leicht auf den Leim gehen, können in solchen Phasen wertvolle Anregungen und Impulse stiften.
Kann „Stören“ denn etwas Positives sein?
Gewöhnlich verbinden wir mit dem Wort „stören“ nichts besonders Angenehmes. Stören bedeutet etwas unterbrechen, Zusammenhänge durcheinanderbringen, Bewährtes irritieren und erinnert sehr schnell auch an Ereignisse, die ganz nahe an „zerstören“ liegen. Die hier nahegelegte Aufforderung, Projektmanagement als eine Inszenierung von Störung zu verstehen zielt weder auf absichtsvolles Zerstören noch auf ein unprofessionelles Management by Helikopter (Staub aufwirbeln und rasch verschwinden). Die Aufforderung zielt vielmehr darauf, den paradoxen Charakter von Projekten genau in den Blick zu nehmen und offensiv zu gestalten. In der Regel werden Projekte angestoßen, initiiert und gestartet, weil irgendwelche besondere Herausforderungen zu bewältigen sind. Und das soll bitte – soweit wie möglich – schnell, diskret, mit möglichst geringem Aufwand und rasch von Statten gehen. An dieser Paradoxie beißen sich dann engagierte Projektleiter mehr oder weniger erfolgreich die Zähne aus, vor allem dann, wenn sie sich selbst begeistert und voller Elan ins Zeug werfen. Projekte scheitern reihenweise, weil diese Paradoxie in den Organisationen so gerne heruntergespielt und negiert wird. In Anlehnung an die neuere Systemtheorie läßt sich das Phänomen so beschreiben: Jede Organisation funktioniert nach einer Reihe von Regeln, Abmachungen und Konventionen, die die Mitglieder im Laufe der Zeit erfunden haben. Das ist, wie wenn die ganze Organisation eine ganz eigene Version von Monopoly oder von Schach spielt [1] . Die „Spielregeln“ bewirken wiederholbare Vorgänge und Arbeitsprozesse - Routinen - und damit zugleich auch Orientierung und Sicherheit für die „Mitspieler“. Man / Frau weiß, was zu tun ist. Wenn in der Systemtheorie dies mit der operativen Schließung eines Systems bezeichnet wird [2] , wird zugleich gesagt, dass das System mit der Erfindung dieser operativen Regeln die Übernahme von anderen, gegebenenfalls durchaus sinnvollen Regeln und Verfahrensweisen abwehrt. Projekte bewegen sich jedoch in der Regel genau in dem Bereich von „Jetzt machen wir ein paar Sachen zumindest vorübergehend einmal anders“ und der dadurch ausgelösten Abwehr. Bereits die Definition von Projekt [3] verweist darauf, wenn als Merkmale sowohl die „Einmaligkeit“ als auch die Notwendigkeit einer eigenen, „projektbezogenen Organisation“ genannt werden. Beide Aspekte signalisieren aus sich heraus einen Widerspruch sowohl zu den spezifischen Routinen wie auch zu den üblichen „Spielregeln“ innerhalb der Organisation. Das bedeutet jedoch nichts anderes, als dass Projekte aus sich heraus „störend“ sind, natürlich in unterschiedlichem Grade, aber dennoch grundsätzlich. Wenn also die Störung schon unvermeidbar ist, dann kann die Devise nur heißen: die Störung konstruktiv gestalten.Inszenieren im Sinne von bewußt gestalten kennen wir vom Theater. Dort ist es die große Kunst des Regisseurs, ein möglicherweise auch altbekanntes Stück richtig in Szene zu setzen. Das ist immer ein spannender Spagat zwischen Langeweile und Provokation, zwischen Bedeutungslosigkeit und Skandal. Hat das Stück eine Botschaft? Geht es lediglich um den ästhetischen Genuß? Welche Wirkung soll auf dem Parkett und in den Logen entstehen? Neben der eher handwerklichen Arbeit am Text sind dies die entscheidenden Fragen, die keine Halbherzigkeit vertragen, sondern nur mit entschiedener Gestaltungskraft zu meistern sind. Wenn die Aufführung die Zuschauer nicht in einem anregenden Maße „stört“, sie also aus der eintönigen Berufswelt herauslockt, zu neuem Nachdenken herausfordert, ihnen Einsichten nahelegt oder ihre Sehnsucht verstärkt, ist das Eintrittsgeld umsonst bezahlt. Der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Professionelles Projektmanagement inszeniert zielgerichtet das unvermeidliche Störungspotential und achtet dabei sowohl auf einen angemessenen Handlungsspielraum der Projektgruppe, als auch auf Annahme, Wirkung und Akzeptanz des Ergebnisses.
Copyright: Rudolf Göser
Erstveröffentlichung
in Wolfgang Antes (Hrsg.): Projektarbeit für Profis.
Münster 2001
[1] Vgl. dazu Helmut Willke, Systemtheorie II: Interventionstheorie, Stuttgart 1994, S. 175
[2] Vgl. ders. S. 74 und 150
[3] Definitionsmerkmale nach DIN 69901